Deine Spende für die Menschen im Iran
Damit Menschenrechte nicht im Dunkeln verschwinden und Gerechtigkeit siegt.

Veröffentlicht am 22.11.2023, zuletzt aktualisiert am 26.2.2024
Medienberichten zufolge wurden in Österreich im Jahr 2023 mindestens 28 Frauen ermordet. Eine Zahl, die wir als Spitze eines Eisbergs betrachten müssen – denn knapp jede dritte Frau in Österreich hat körperliche und/oder sexualisierte Gewalt erlebt. Wie können Femizide verhindert werden? Was können wir alle gegen Gewalt an Frauen tun? Im folgenden Text erfährst du, welche Ursachen dem gesamtgesellschaftlichen Problem der Femizide zugrunde liegen. Und was geschehen muss, um ein Leben ohne Gewalt für alle Frauen zu schaffen – weltweit und in Österreich.
> Definition: Was sind Femizide und wo liegen die Ursachen für Femizide?
> Wie ist Femizid als Menschenrechtsverletzung definiert?
> Statistiken über Femizide und Gewalt an Frauen weltweit und in Österreich
> Wie ist die Situation in Österreich?
> Wo finden von Gewalt betroffene Frauen Hilfe?
> Was fordert Amnesty International?
> Was kann jede*r einzelne von uns gegen Gewalt an Frauen und Femizide tun?
Der Begriff Femizide bezeichnet die gezielte (bewusste) Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Der Femizid ist die extremste Manifestation der Gewalt gegen Frauen und betrifft alle Regionen und Länder weltweit.
Der Begriff Femizid wurde entwickelt, um bestimmte Tötungen an Frauen von anderen Formen tödlicher Gewalt abzugrenzen und als spezifisches Phänomen zu problematisieren. Femizide unterscheiden sich von anderen Arten der Tötung, da sie auf Geschlecht und Geschlechterdiskriminierung abzielen. Frauen werden allein aufgrund ihres Geschlechts zur Zielscheibe gemacht, und das geschieht oft in einem Kontext, in dem bereits Gewalt, sexueller Missbrauch, Machtungleichgewicht und Bedrohungen gegenüber den Opfern vorhanden waren.
Die Gründe für Femizide reichen von patriarchalen Strukturen und traditionellen Geschlechterrollen bis hin zu wirtschaftlichen und sozialen Faktoren. Femizide werden oft von Partnern oder Ex-Partnern begangen. Um Femizide zu bekämpfen, ist es daher unumgänglich, häusliche Gewalt und Beziehungsmissbrauch ernsthaft zu adressieren. Dieser so genannte Intim-Femizid, der mit der Tötung von Frauen als Folge von partnerschaftlicher Gewalt in Verbindung steht, ist die häufigste Form des Femizids. Der Begriff Femizid umfasst außerdem Gewaltakte wie die Tötung von Frauen und Mädchen als Folge oder zum Zweck sexualisierter Gewalt, die Folter und die misogyn motivierte Tötung von Frauen und ehrbasierte Tötung von Frauen und Mädchen.
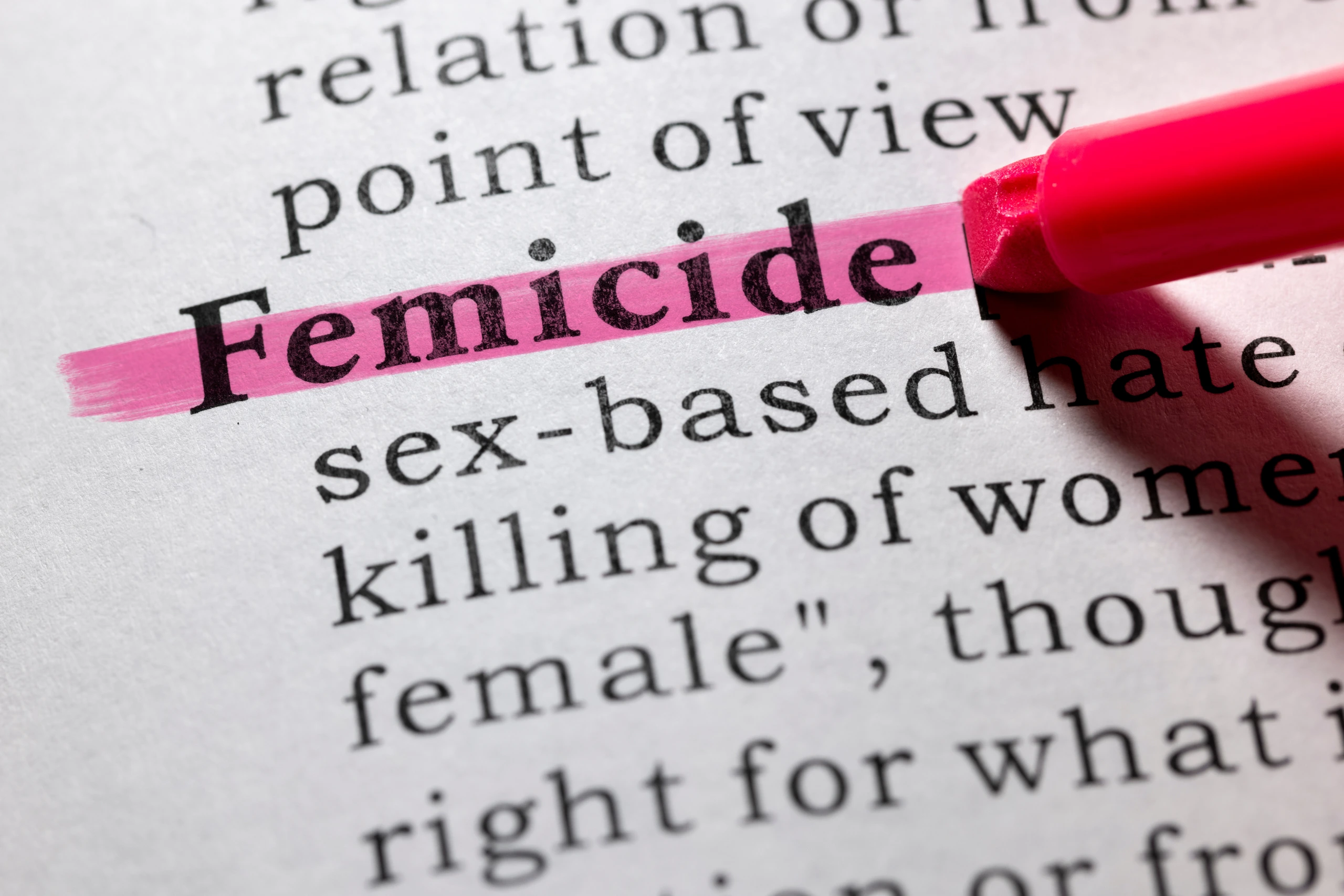
Der Begriff Femizid bezeichnet die Ermordung von Frauen durch Männer aufgrund ihres Geschlechtes. Im Gegensatz dazu beleuchtet der Begriff Feminizide die Verantwortung staatlicher Institutionen und Akteur*innen im Kampf gegen die Tötung von Frauen. Der Begriff bezieht mit ein, welche Maßnahmen seitens des Staates ergriffen werden, um solche Tötungen zu verhindern.
Das Konzept der Femizide wurde 1976 von der Soziologin, Autorin und feministischen Aktivistin Diana Russell beim von ihr mitorganisierten Internationalen Tribunal für Verbrechen gegen Frauen in Brüssel eingeführt. Für Russell war es das Wort, das „am besten die Morde von Männern beschreibt, motiviert durch Verachtung, Hass, Vergnügen oder das Gefühl des Besitzes über Frauen.”
Der Begriff Feminizid hingegen wurde 1994 von der mexikanischen Anthropologin, Politikerin, und feministischen Aktivistin Marcela Lagarde geprägt, in Reaktion auf die schrecklichen Serienmorde, die in der mexikanischen Stadt Ciudad Juárez über mehr als ein Jahrzehnt verübt wurden. Teil dieser Morde waren Vergewaltigungen, Folter und Leichen, die in Baumwollfelder geworfen wurden – ohne angemessene Reaktion seitens des mexikanischen Staates. Daher bezieht sich der Feminizid auf die staatliche Straflosigkeit bei der Verurteilung von Morden an Frauen.
Wie oben erwähnt, geschehen Femizide nicht im luftleeren Raum, sondern meist in einem Kontext, in dem bereits andere Arten der Gewalt gegen Frauen vorherrschen. Gewalt an Frauen ist eine weitverbreitete Form von geschlechtsspezifischer Gewalt, bei der Frauen aufgrund ihres Geschlechts Opfer von physischer, sexualisierter, psychischer, emotionaler oder ökonomischer Gewalt werden. Es ist auch als geschlechtsspezifische Gewalt zu werten, wenn Frauen daran gehindert werden, über ihr Leben und ihren Körper zu entscheiden. Die Allgemeine Empfehlung Nr. 19 des CEDAW-Übereinkommens betont, dass Gewalt gegen Frauen, insbesondere geschlechtsbezogene Gewalt, eine Form der Diskriminierung darstellt, die die Fähigkeit von Frauen erheblich einschränkt, ihre Rechte und Freiheiten auf der Grundlage von Gleichberechtigung mit Männern zu genießen.
Gewalt gegen Frauen kann unter anderem in den folgenden Formen auftreten:
In den internationalen Menschenrechtsstandards wurden eine Reihe von Normen und Grundsätzen entwickelt, um Rechte von Frauen zu gewährleisten. Das Recht der Frauen auf ein Leben frei von Gewalt ist im internationalen Menschenrechtssystem verankert.
Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) wurde 1979 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Konsens angenommen. CEDAW verpflichtet zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von Frauen und dazu, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um diskriminierende Gesetze, Vorschriften, Bräuche und Praktiken zu ändern oder aufzuheben. Die 1993 verabschiedete Erklärung zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen enthält Normen und Grundsätze, die zu Quellen des Völkerrechts geworden sind.
In Lateinamerika wurde 1994 das Interamerikanische Übereinkommen zur Verhütung, Bestrafung und Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, auch bekannt als das Übereinkommen von Belém do Pará, verabschiedet. Das Übereinkommen war der erste verbindliche internationale Vertrag, der das Recht auf ein Leben frei von Gewalt sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich als Menschenrecht anerkennt (Artikel 3). Er definiert Gewalt gegen Frauen als "jede Handlung oder jedes Verhalten aufgrund des Geschlechts, das Tod oder körperliche, sexuelle oder seelische Schäden oder Leiden für Frauen verursacht, sei es im öffentlichen oder privaten Bereich" (Artikel 1). Die Vertragsstaaten des Übereinkommens von Belém do Pará sind verpflichtet, mit allen geeigneten Mitteln und unverzüglich Maßnahmen zur Verhütung, Bestrafung und Beseitigung aller Formen von Gewalt gegen Frauen zu ergreifen (Artikel 7). Aus dieser von den Vertragsstaaten übernommenen Verpflichtung folgt, dass ein Staat, der Frauenmorde nicht mit der gebotenen Sorgfalt verhindert, untersucht oder bestraft, seiner Verpflichtung, unter anderem das Recht auf Leben zu garantieren, nicht nachkommt. Das Fehlen eines angemessenen Schutzes für Frauen durch den Staat und das Versäumnis, Gewalt gegen sie zu verhindern und zu untersuchen, ist eine Verletzung der Verpflichtung des Staates, die völkerrechtlich anerkannten Menschenrechte zu achten, zu schützen und zu erfüllen.
Im Jahr 2009 fällte der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte (IACtHR) ein wegweisendes Urteil im berüchtigten Femizid-Fall González y otras "campo algodonero" vs. México (spanisch für „González et al. "Baumwollfeld" gegen Mexiko) über die bereits oben erwähnten Serienmorde an Frauen in Ciudad Juárez in Mexiko. Das Urteil bestätigte das Konzept des Femizids als geschlechtsbasierter Mord und die klare Verpflichtung des Staates, das Problem anzugehen und die Täter vor Gericht zu bringen.
Auch die Europäische Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (so genannte „Istanbul-Konvention”) hat zum Ziel, insbesondere Frauen vor jeglicher Form geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen, solche Gewalt zu verhindern und die Täter*innen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Istanbul-Konvention wurde 2011 vom Ministerkomitee des Europarates verabschiedet und ist das erste Instrument in Europa, das rechtsverbindliche Standards zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt setzt. Sie wurde von allen EU-Mitgliedsstaaten unterzeichnet und von 21 Staaten ratifiziert (Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien und Schweden).
Das Protokoll zur Afrikanischen Menschen- und Völkerrechtscharta betreffend Frauenrechte in Afrika (das so genannte „Maputo-Protokoll”) wurde von der Afrikanischen Union am 11. Juli 2003 verabschiedet und trat am 25. November 2005 in Kraft. 43 Staaten haben es inzwischen unterzeichnet. Das Dokument formuliert in insgesamt 31 Artikeln spezifische Rechtsansprüche zum Schutz von Frauen und Mädchen in Afrika unter Berücksichtigung der sozio-kulturellen Rahmenbedingungen. Das umfasst die Garantie und Anerkennung ziviler, politischer, ökonomischer und kultureller Rechte für Frauen aber auch besonderen Schutz von Frauen in bewaffneten Konflikten, vor Ausbeutung und vor Entwürdigung sowie vor gesundheitsschädigenden traditionellen Praktiken, etwa der weiblichen Genitalverstümmelung.
Laut einem UN-Bericht wurden im Jahr 2022 rund 89.000 Frauen und Mädchen vorsätzlich getötet – der höchste Stand seit 20 Jahren.
Die meisten Tötungen von Frauen und Mädchen haben geschlechtsspezifische Motive. Im Jahr 2022 wurden weltweit rund 48.800 Frauen und Mädchen von ihren Partnern oder anderen Familienmitgliedern getötet. Das bedeutet, dass im Durchschnitt jeden Tag mehr als 133 Frauen oder Mädchen von einer Person aus ihrer eigenen Familie getötet wurden.
Die meisten vorsätzlichen Tötungsdelikte an Frauen und Mädchen sind geschlechtsspezifisch. Das wahre Ausmaß des Problems könnte allerdings noch größer sein. Die Schätzungen sind möglicherweise zu niedrig angesetzt, da in etwa vier von zehn Fällen nicht ausreichend Informationen vorhanden sind, um geschlechtsspezifische Motivationen zu identifizieren.

In Österreich ist beinahe jede dritte Frau ab dem Alter von 15 Jahren von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen, sowohl innerhalb als auch außerhalb von intimen Beziehungen. Die Statistiken zeigen, dass dieser Anteil fast 35% der weiblichen Bevölkerung ausmacht. (2021, Quelle: Statistik Austria)
Im Jahr 2022 wurden laut polizeilicher Kriminalstatistik 29 Frauen – häufig von ihren (Ex-)Partnern oder Familienmitgliedern – ermordet. Davor gab es im Jahr 2018 einen Höchststand von 41 Morden an Frauen. Zum Vergleich: 2014 wurden 19 Frauen umgebracht. Es kam also in diesem Zeitraum zu mehr als einer Verdoppelung der ermordeten Frauen – ein trauriger Rekord. Monatlich werden mittlerweile etwa 3 Frauen ermordet. Beim überwiegenden Teil der Morde an Frauen bestand ein Beziehungs- oder familiäres Verhältnis (z.B. Partner oder Ex-Partner oder Familienmitglied) zwischen Täter und Opfer. Im Jahr 2023 wurden laut Medienberichten 28 Frauen ermordet, davon waren mutmaßlich 26 Femizide, und es gab 41 Mordversuche bzw. Fälle schwerer Gewalt an Frauen.
Im Jahr 2018 führte Österreich die Spitze der EU-Statistik über Frauenmorden an. Auffallend ist außerdem, dass in Österreich mehr Frauenmorde als Morde an Männern geschehen.
Frauenmorde in Österreich aus der Polizeistatistik der Jahre 2014-2022 (Quelle: aoef.at)
Österreich hat seit 1997 ein Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie (Gewaltschutzgesetz) und war eines der ersten europäischen Länder, in dem der Schutz vor häuslicher Gewalt gesetzlich geregelt wurde. Beim Gewaltschutzgesetz handelt sich um eine Reihe von Änderungen in verschiedenen Gesetzesmaterien mit dem Ziel, einen erweiterten, effizienten und schnellen Schutz für alle Formen von Gewalt (physischer, psychischer oder sexualisierter Gewalt) im Familienkreis zu gewährleisten.
Das Gewaltschutzgesetz erlaubt von häuslicher Gewalt betroffenen Personen in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben, während die gewalttätige Person die gemeinsame Wohnung verlassen muss. Die Neuerung der polizeilichen Wegweisung ermöglichte es, dass die gefährliche Person aus der Wohnung verwiesen wird. Das Gesetz umfasst auch zivilrechtliche Schutzmaßnahmen und die Unterstützung durch Interventionsstellen zur unmittelbaren Hilfe und Beratung der Betroffenen.
2009 wurde das sogenannte Zweite Gewaltschutzgesetz eingeführt, welches den Schutz für Opfer wesentlich verbessert und ihre Unterstützung erweitert hat.
Im Herbst 2013 wurde die jüngste Gesetznovelle wirksam, die darauf abzielte, den Schutz von Kindern, die von Gewalt betroffen sind, zu verbessern. Die Bestimmungen dieser Gesetze erstrecken sich auf polizeiliche und zivilrechtliche Schutzmaßnahmen, strafrechtliche Sanktionen sowie die Rechte von Opfern. Jede Person, die sich in Österreich aufhält, genießt Schutz vor Gewalt, unabhängig von ihrer Herkunft oder Staatsbürgerschaft.
Gemäß Artikel 10 der Istanbul-Konvention sind die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, zumindest eine offizielle Koordinierungsstelle einzurichten. Österreich setzte diese Verpflichtung im Sommer 2015 um, indem es die Koordinierungsstelle "Schutz von Frauen vor Gewalt" in der Abteilung III/4 Gewaltprävention und Gewaltschutz im Bundeskanzleramt ins Leben rief. Die zentralen Aufgaben der nationalen Koordinierungsstelle umfassen die Koordinierung der Berichterstattung gemäß der Istanbul-Konvention, die Darstellung nationaler Koordinierungsmaßnahmen, die Aufbereitung von Daten und Statistiken sowie die Sammlung relevanter Dokumente.
Es gibt in allen österreichischen Bundesländern verschiedene Beratungs- und Hilfsangebote, wie zum Beispiel Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen. In Wien existiert eine FGM-Koordinationsstelle, die Beratung, Informationsaustausch und Unterstützung zu Fragen im Zusammenhang mit weiblicher Genitalverstümmelung anbietet.
Die Frauenhäuser agieren nach klaren Grundsätzen: Hilfe wird unbürokratisch und sofort geleistet, die Anonymität der betroffenen Frauen bleibt geschützt, Frauen leiten die Einrichtungen, Mitarbeiterinnen beraten und unterstützen betroffene Frauen, wobei Männer im Allgemeinen keinen Zutritt haben. Die unterstützenden Frauen stehen fest an der Seite der Betroffenen.
Leider erfüllen in Österreich nicht alle Bundesländer die Istanbul-Konvention hinsichtlich ausreichender Frauenhausplätze. Salzburg weist mit nur 15 Plätzen einen Mangel von rund 42 Plätzen auf. Zudem mangelt es vielen Frauenhäusern an ausreichendem Personal, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung.
Die Wohnsituation nach dem Frauenhausaufenthalt gestaltet sich generell schwierig, da betroffene Frauen kaum leistbaren Wohnraum finden. Laut dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser zwingt das viele dazu, zu ihren Misshandlern zurückzukehren, was nicht nur eine prekäre Lebenslage schafft, sondern auch als Menschenrechtsverletzung betrachtet werden kann. Der Mangel an angemessenem Wohnraum nach der Flucht vor häuslicher Gewalt stellt eine Bedrohung für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Betroffenen dar.
In Österreich wurden wichtige Fortschritte erzielt, um Gewalt an Frauen zu verhindern, dazu zählt auch die Einrichtung der erwähnten FGM-Koordinationsstelle, die Erhöhung der Finanzmittel für Beratungsstellen und die Hotline für Frauen. Dennoch sind die Zahlen der von Gewalt betroffenen Frauen immer noch zu hoch und es bleibt viel zu tun. Österreich muss Maßnahmen ergreifen, um das Bewusstsein für geschlechtsspezifische Gewalt zu schärfen, und um sowohl Stigmatisierung als auch Hindernisse in der Strafverfolgung zu beseitigen. Es ist außerdem dringend notwendig, dass in ganz Österreich ausreichend Plätze in Frauenhäusern sichergestellt werden. Mehr zu unseren Forderungen findest du weiter unten.
Die Regierung hat in den letzten Jahren wichtige Fortschritte erzielt. Dennoch sind die Zahlen der von Gewalt betroffenen Frauen immer noch zu hoch. Die 26 Femizide, die wir heuer bereits zu verzeichnen haben, sind 26 zu viel.
Aimée Stuflesser, Juristin bei Amnesty International Österreich
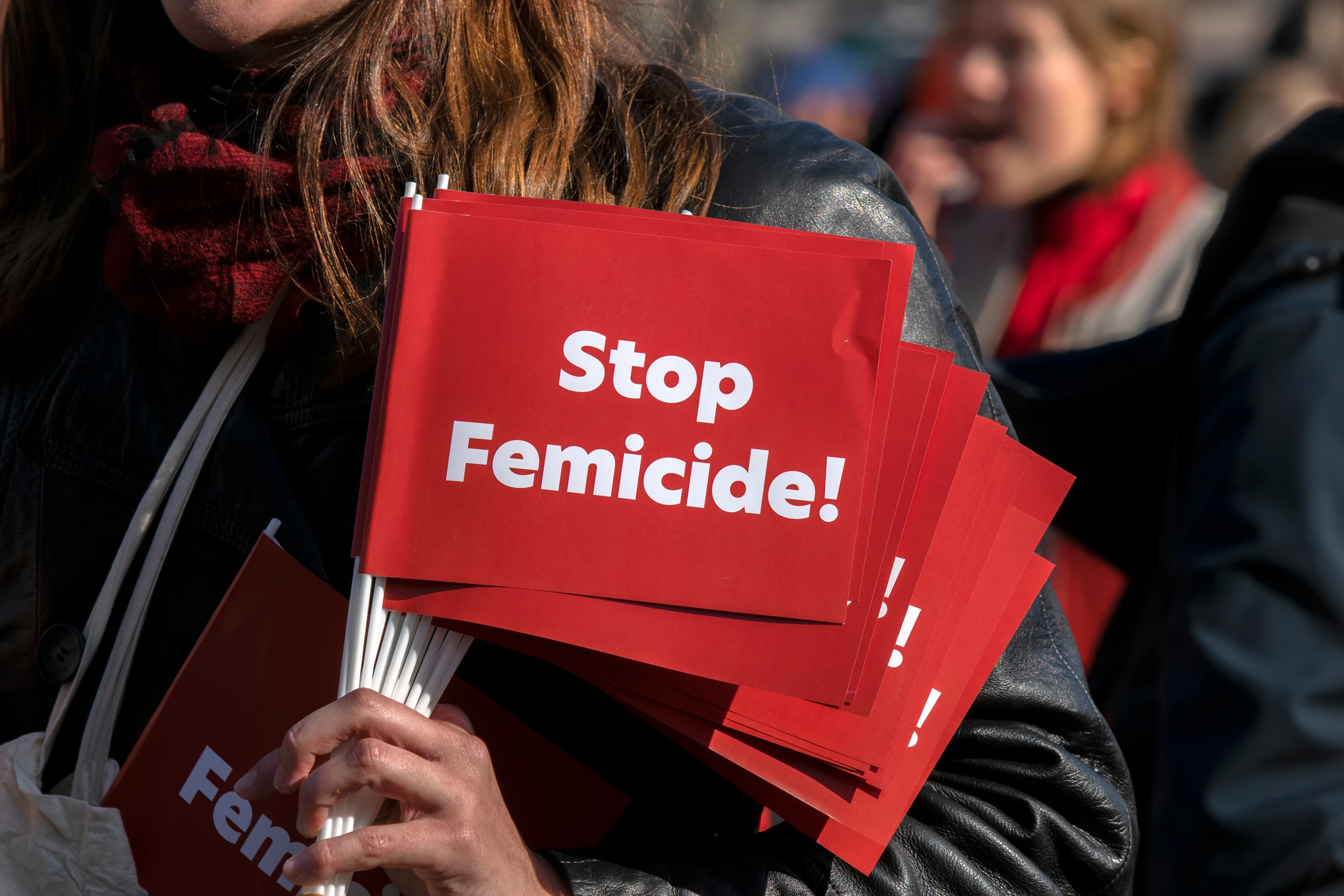
In Österreich gibt es eine telefonische Frauen-Helpline gegen Gewalt (Tel: 0800 222 555), die Frauen 365 Tage im Jahr rund um die Uhr anonyme und kostenlose Beratung anbietet. Die Helpline steht für Frauen zur Verfügung, die von Männergewalt, Stalking, Zwangsheirat und Beziehungs- oder Lebenskrisen betroffen sind. Das Team von Expertinnen vermittelt an regionale Frauenschutzeinrichtungen, bietet Unterstützung in rechtlichen und sozialen Fragen im Zusammenhang mit Gewalt und informiert über weitere Beratungsangebote in ganz Österreich. Hilfe wird in verschiedenen Sprachen angeboten. In Österreich gibt es außerdem eine Online-Beratung, die Hilfe bei allen Formen der Gewalt wie körperliche, seelische, sexualisierte, psychische, familiäre Gewalt sowie digitale Gewalt und Hass im Netz anbietet: HelpCh@t
Staaten haben die menschenrechtliche Verpflichtung, geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern, Täter zu verfolgen und Opfern Zugang zu Schutz, Unterstützung und Wiedergutmachung auf zeitnahe, angemessene und effiziente Weise zu gewähren. Daher fordern wir die österreichischen Behörden auf, die folgenden Maßnahmen umzusetzen.
Gewalt gegen Frauen ist nicht nur das individuelle Problem betroffener Frauen, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Die Initiative „16 Tage gegen Gewalt an Frauen” umfasst die Zeit zwischen dem 25. November – dem internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden – und dem 10. Dezember – dem internationalen Tag der Menschenrechte. Dieser Aktionszeitraum wird weltweit genutzt, um das Ausmaß und die verschiedenen Ausprägungen von Gewalt gegen Frauen zu thematisieren und Bewusstsein dafür zu schaffen.
Der Gedenktag geht auf die Ermordung der 3 Schwestern Mirabal zurück, die am 25. November 1960 in der Dominikanischen Republik vom militärischen Geheimdienst getötet wurden. Sie waren im Untergrund tätig und hatten sich an Aktivitäten im Widerstand gegen das Regime des Diktators Rafael Trujillo beteiligt.
Weltweit erstrahlen anlässlich der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" in der Zeit von 25. November bis 10. Dezember Gebäude in oranger Farbe als sichtbares Zeichen der Solidarität mit Opfern von geschlechtsspezifischer Gewalt. Das weltweite Problem soll sichtbar gemacht und enttabuisiert werden.
Seit 1999 ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen von den Vereinten Nationen anerkannt. Im Jahr 2008 riefen die UN Kampagne "UNiTE to End Violence against Women by 2030" ins Leben unter dem Titel “Orange The World”.

Lasst uns zusammenstehen, um betroffene Frauen zu unterstützen, Täter zur Rechenschaft zu ziehen und eine Welt ohne Gewalt für alle Frauen zu schaffen. Jede*r einzelne von uns kann einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Femiziden leisten.