Deine Spende für die Menschen im Iran
Damit Menschenrechte nicht im Dunkeln verschwinden und Gerechtigkeit siegt.
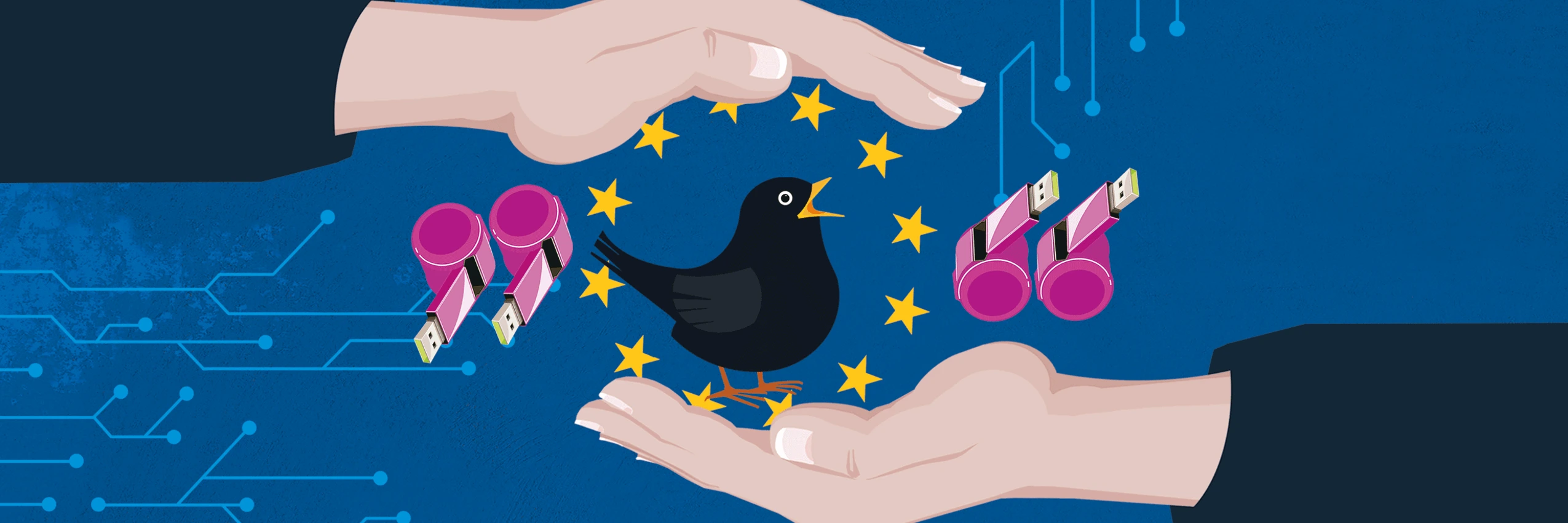
Veröffentlicht am 2.5.2022, zuletzt aktualisiert am 23.6.2022
Sie riskieren oft ihre Existenz, um Missstände aufzudecken: Whistleblower*innen. Von Chelsea Manning bis Edward Snowden können Whistleblower*innen eine wichtige Rolle für unsere Menschenrechte spielen und nehmen dafür meist große persönliche Risiken auf sich. Im folgenden Text erfährst du, wie Whistleblowing definiert wird, wie die rechtliche Lage in Österreich aussieht und warum wir Whistleblower*innen dringend besser schützen müssen, um Menschenrechte zu wahren – in Österreich und weltweit.
> Definition und Beispiele: Was ist Whistleblowing?
> Was hat Whistleblowing mit Menschenrechten zu tun?
> Warum ist es wichtig für unsere Menschenrechte, Whistleblower*innen zu schützen?
> Worum geht es bei der EU-Whistleblower*innen-Richtlinie?
> Wie sieht die Situation für Whisteblower*innen in Österreich aus?
Whistleblower*innen, auf Deutsch oft Hinweisgeber*innen, sind Personen, die für die Allgemeinheit wichtige Informationen aus einem geheimen oder geschützten Zusammenhang heraus öffentlich machen. Dazu zählen Missstände, Menschenrechtsverletzungen, Datenmissbrauch oder Straftaten wie z.B. Korruption oder Insiderhandel. Entscheidend für die Definition von Whistleblower*innen ist, dass die Personen bedeutsame Informationen aus ihrem eigenen Umfeld beziehungsweise ihrer Tätigkeit erlangen – etwa am Arbeitsplatz, in einer Institution oder in einem Verein – und diese öffentlich machen. Die Weitergabe der Informationen ist daher für Whistleblower*innen oftmals sehr heikel und mit großen persönlichen Risiken verbunden, zum Beispiel mit dem drohenden Verlust des Arbeitsplatzes oder strafrechtlichen Konsequenzen.
Es gibt international zahlreiche Skandale, die ohne Whistleblower*innen höchstwahrscheinlich nie aufgedeckt worden wären. Die wohl bekannteste Plattform für Enthüllungen ist Wikileaks, gegründet von Julian Assange. Hier enthüllte die ehemalige Angehörige der US-Streitkräfte und IT-Spezialistin Chelsea Manning durch die Weitergabe von Informationen und Dokumenten Menschenrechtsverletzungen im Irak-Krieg und über das Gefangenenlager Guantánamo.
Der ehemalige Geheimdienst-Mitarbeiter und IT-Sicherheitstechniker Edward Snowden legte das Ausmaß der Überwachung durch den US-Geheimdienst NSA offen. Im Juni 2013 übergab Edward Snowden Journalist*innen eine große Zahl von Geheimdienstdokumenten, die er bei seiner Tätigkeit als NSA-Mitarbeiter gesammelt hatte. Diese Dokumente enthüllten die elektronische Überwachung der Internet- und Telefonaktivitäten von Millionen von Menschen weltweit durch die US-Regierung und ihre Verbündeten.
Zu den jüngsten Beispielen für Whistleblower*innen zählt auch die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen, die den mangelhaften Umgang des Konzerns mit Hate Speech und der Sicherheit der Nutzer*innen anprangerte. Frances Haugen zeigte auf, dass sich die Facebook-Führung weigerte, Änderungen vorzunehmen, die ihre Plattformen sicherer machen würden.
Whisteblowing ist oftmals die einzige Möglichkeit, Menschenrechtsverletzungen ans Licht zu bringen, die der Öffentlichkeit sonst verborgen bleiben würden. Das ist auch beim Aufdecken von Korruption der Fall, die eine Vielzahl unserer Menschenrechte verletzen kann. Die folgenden Beispiele veranschaulichen, welche gravierenden Menschenrechtsverletzungen durch Whistleblower*innen aufgedeckt wurden – weltweit und auch in Österreich. Die Beispiele zeigen außerdem, dass in vielen Fällen nicht diejenigen verfolgt werden, die Menschenrechte verletzt haben, sondern jene, die diese menschenrechtswidrigen Handlungen enthüllten.
Die Ärztin Tatyana Revva aus der südrussischen Oblast Wolgograd prangerte die unzureichende Schutzausrüstung für das Personal und andere Probleme in ihrem Krankenhaus im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie an. Sie meldete ihre Bedenken der unabhängigen Ärztegewerkschaft und beschrieb in einem Video die Probleme, mit denen das Personal in ihrem Krankenhaus konfrontiert ist. Sowohl das Schreiben an die Gewerkschaft als auch das Video sind veröffentlicht worden. In der Folge wurde Tatyana Revva mit Disziplinarmaßnahmen überzogen und mit Entlassung bedroht. Dabei hat sie Fragen angesprochen, die von öffentlichem Interesse sind und damit dazu beigetragen, dass wirksame Maßnahmen gegen die weitere Verbreitung des Corona-Virus getroffen werden können und das Recht auf Gesundheit der Menschen geschützt werden kann. Amnesty International forderte gemeinsam mit tausenden Unterstützer*innen, dass die Repressionen gegen Tatyana Revva sofort aufhören müssen. Die internationale Unterstützung hat nach Einschätzung von Tatyana Revva dazu beigetragen, ihre drohende Entlassung zu verhindern. Sie setzt ihre Arbeit im Krankenhaus fort und behandelt unter anderem weiter COVID-19-Patienten. Zu den Arbeitsbedingungen wird sie sich weiterhin offen äußern.

In den von Chelsea Manning an Wikileaks weitergegebenen Irak-Dokumenten finden sich u.a. 303 Fälle von Folter durch US- und andere Koalitionstruppen im Irak im Jahr 2010. Zu den von Manning enthüllten Informationen gehörten auch vorher unveröffentlichte Aufnahmen von Zivilpersonen, die bei US-Hubschrauberangriffen getötet wurden. Das Video wurde später unter dem Titel „Collateral Murder“ veröffentlicht und erregte großes Aufsehen. Es zeigt den Beschuss und Tod irakischer Zivilpersonen und Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters am 12. Juli 2007 in Bagdad. Zwölf Menschen starben, darunter die zwei Reuters-Reporter. Zwei Kinder wurden schwer verletzt. Chelsea Manning wurde 2010 wegen der Weitergabe geheimer US-Dokumente festgenommen und unter anderem wegen Spionage angeklagt. Sie wurde zu einer Haftstrafe von 35 Jahren verurteilt. Im Januar 2017 begnadigte sie Präsident Barack Obama. So hoch das Strafmaß für Chelsea Manning war, so glimpflich kamen die Piloten der beiden US-Kampfhubschrauber davon, die für den Tod von 12 Zivilpersonen und zwei Reuters-Reportern verantwortlich sind. Die US-Armee untersuchte den Vorfall, jedoch mit dem Ergebnis, dass das Verhalten der Piloten und der Angriff konform mit den Einsatzregeln des US-Militärs im Irak seien. Ein Gerichtsverfahren gab es deshalb nicht.

Der Webentwickler Gökhan Sagir entdeckte beim Programmieren für eine österreichische Apotheke eine Sicherheitslücke in Zusammenhang mit der Anmeldung für COVID-19-Tests auf einer Website des Gesundheitsministeriums (österreich-testet.at). Über diese Lücke war es möglich, persönliche Daten von potenziell hunderttausenden Personen in Österreich aus dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) abzurufen, was eine massive Verletzung ihres Rechts auf Privatsphäre darstellen würde. Der Entwickler dokumentierte die Lücke und meldete sie dem Gesundheitsministerium, worauf er von den Behörden zuerst ignoriert und dann angegriffen wurde. Die Apotheke wurde von österreich-testet.at ausgeschlossen, die in der Folge das Arbeitsverhältnis mit Gökhan Sagir beendete. Der Webentwickler, der mit der Dokumentation und Meldung der Sicherheitslücke im Interesse der Öffentlichkeit handelte, verlor seinen Job.

Edward Snowden enthüllte, dass der amerikanische Geheimdienst NSA in großem Ausmaß die Rechner großer Internetfirmen anzapft und so Zugang zu Videos, Fotos, E-Mails und Kontaktdaten von Millionen Nutzer*innen bekommt. Damit deckte er die Verletzung des Rechts auf Privatsphäre von Millionen Menschen weltweit auf. Als Reaktion auf die Snowden-Enthüllungen ordnete Präsident Obama die Nachrichtendienste an, wichtige Änderungen bei ihren Überwachungspraktiken vorzunehmen. Im Jahr 2015 schränkte der US-Kongress die staatlichen Überwachungskompetenzen zum ersten Mal seit fast vierzig Jahren ein, nachdem ein Bundesgericht entschieden hatte, dass das Sammeln von Informationen über praktisch alle Telefonanrufe in den USA durch die NSA illegal war. Doch Edward Snowden drohen für sein Handeln Jahrzehnte im Gefängnis, nur weil er die Menschenrechte verteidigt hat. Er lebt im russischen Exil, von seiner Familie getrennt und als Staatsfeind behandelt. Amnesty International hat die US-Regierung wiederholt aufgefordert, die Anklage gegen Edward Snowden fallenzulassen.

Whistleblowing ist vom Menschenrecht der Meinungsfreiheit gedeckt (Art. 19 AEdMR, Art. 19 IPBürg, Art. 10 EMRK). Es dient zudem der allgemeinen Informationsfreiheit aller Menschen, die ohne das Whistleblowing nicht von den Missständen erfahren würden. Wenn Whistleblower*innen Informationen über Menschenrechtsverletzungen aufdecken, um auf diese aufmerksam zu machen und sie zu bekämpfen, verdienen sie besonderen Schutz. Sie dürfen keinen unverhältnismäßigen Sanktionen wie z.B. exzessiven strafrechtlichen Sanktionen ausgesetzt sein. Je nach den konkreten Umständen des Falls kann auch die vollständige Straffreiheit der Informationsweitergabe menschenrechtlich geboten sein.
Alle Staaten müssen in ihrer nationalen Gesetzgebung, insbesondere im Bereich des Strafrechts und des Arbeitsrechts (Kündigung), Vorkehrungen zum Schutz von Whistleblower*innen treffen. Sie müssen dafür sorgen, dass die Gerichte bei der Anwendung des Rechts in diesen Fällen den menschenrechtlich gebotenen Schutz berücksichtigen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat für den Schutz von Whistleblower*innen Kriterien aufgestellt, nach denen die Schutzwürdigkeit der Informationsweitergabe bestimmt wird. Diese Kriterien müssen von den Mitgliedstaaten des Europarates im Umgang mit Whistleblower*innen berücksichtigt werden. Danach kommt es maßgeblich an auf:

Die EU-Whistleblower*innen-Richtlinie sieht einen besseren Schutz für Menschen vor, die mit im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit erhaltenen Informationen auf korrupte Handlungen hinweisen und diese aufdecken. Sie umfasst einerseits die Verpflichtung für Unternehmen und Institutionen, Meldestellen für Hinweisgeber*innen zum Abgeben von Informationen einzurichten. Solche bestenfalls digitalen Meldestellen müssen von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen ab einer Größe von 50 Mitarbeiter*innen eingerichtet werden (ab dem Jahr 2022) sowie von Behörden und Gemeinden ab 10.000 Einwohner*innen. Andererseits umfasst die EU-Whistleblower*innen-Richtlinie die sogenannte Beweislastumkehr, mit der Whistleblower*innen geschützt werden: Unternehmen müssen beweisen, dass eine Anschuldigung nicht der Wahrheit entspricht.
Die EU-Whistleblower*innen-Richtlinie schützt aktuell nur die Offenlegung von EU-Rechtsverstößen, d.h. Hinweisgeber*innen, die auf andere Rechtsverstöße hinweisen, erfasst ihr Schutz nicht. Das stellt eine Lücke dar, die dringend geschlossen werden muss, um Whistleblower*innen umfassend zu schützen.
Die EU-Whistleblower*innen-Richtlinie hätte bereits bis Dezember 2021 von den Mitgliedstaaten umgesetzt, also in nationales Recht gegossen werden sollen.
Österreich blieb bei der Umsetzung der EU-Whistleblower*innen-Richtlinie lange säumig, obwohl die Umsetzung zentral für die Ausübung der Meinungsäußerungs-, Presse- und Informationsfreiheit ist. Sie hätte bereits bis Dezember 2021 von den EU-Mitgliedsstaaten umgesetzt werden sollen. Die EU-Kommission leitete ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Am 3.6.2022, mehr als fünf Monate nach Ende der von der EU-Kommission vorgegebenen Deadline, hat Arbeitsminister Kocher den österreichischen Gesetzentwurf vorgestellt.
Amnesty International fordert eine menschenrechtskonforme Implementierung der EU- Whistleblower*innen-Richtlinie. Dafür dürfen Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit erhaltene Informationen über Menschenrechtsverletzungen in einer verantwortungsvollen Weise offenlegen, nicht strafrechtlich verfolgt werden.
Allerdings schützt die EU-Whistleblower*innen-Richtlinie, wie im oberen Abschnitt erklärt, aktuell nur die Offenlegung von EU-Rechtsverstößen. Das heißt in der Praxis: Die Richtlinie schützt Whistleblower*innen nur dann, wenn diese Verstöße gegen EU-Recht melden. Für Österreich bedeutet das, dass bei der Umsetzung der EU-Whistleblower*innen-Richtlinie dringend auch die Aufdeckung von Informationen über Verstöße gegen andere – nationale oder völkerrechtliche – Rechtsquellen geschützt werden muss. Für einen umfassenden und menschenrechtskonformen Schutz von Whistleblower*innen muss jedenfalls die Offenlegung folgender Missstände geschützt sein:
Besonders wichtig ist es auch, dass Whistleblower*innen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Hinweise anonym weiterzugeben und dass es auch externe Beschwerdestellen gibt, wenn die Meldung an eine interne Beschwerdestelle in einem bestimmten Fall nicht zugemutet werden kann.
Das am 3.6.2022 vorgestelle Gesetz wird einerseits endlich einen besseren Schutz bei Hinweisen gegen Korruptionsstrafrecht, Umweltschutz oder öffentliches Auftragswesen bringen. Andererseits sind für einen umfassenden und menschenrechtskonformen Whistleblower*innenschutz aus Sicht von Amnesty International Österreich noch Verbesserungen nachzuholen:
Wir beobachten in Österreich außerdem, dass es unabhängige und kritische Journalist*innen, die zu Korruption recherchieren und Informationen über korrupte Handlungen durch Personen aus dem politischen Umfeld veröffentlichen, vermehrt mit Einschüchterung zu tun bekommen. Auch im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen ist Österreich aus diesem Grund in den letzten Jahren um viele Plätze gesunken.
Wie oben dargelegt werden Whistleblower*innen in Österreich derzeit nicht ausreichend geschützt. Wenn du also selbst Informationen teilen möchtest, die für die Allgemeinheit von Bedeutung sein könnten, gehe mit Bedacht und wohlüberlegt vor.
Korruption bei Behörden melden
Wenn du den Verdacht hast, Zeug*in von offenbar korrupten Handlungen geworden zu sein, besteht in Österreich grundsätzlich die Möglichkeit, dich an behördliche Meldestellen für Korruption zu wenden, also an das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK). Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bietet ein Hinweisgeber*innen-System in Form einer digitalen Kommunikationsplattform. Hier können anonym Hinweise auf Korruption abgegeben werden. Auch die Finanzmarktaufsicht (FMA) betreibt ein Online-Meldesystem, wo Hinweisgeber*innen Verstöße von Organisationen melden können, die der Aufsicht der FMA unterliegen.
Weitere Briefkästen und Meldestellen
Auch wenn Österreich die EU-Whistleblower*innen-Richtlinie noch nicht umgesetzt hat, haben einige Unternehmen und Einrichtungen trotzdem bereits interne Meldestellen eingerichtet. Die Stadt Wien etwa bietet ein Hinweisgeber*innen-System, wo Verstöße von Mitarbeiter*innen der Stadt Wien gemeldet werden können. Auch manche Medienredaktionen bieten sogenannte anonyme Briefkästen in digitaler Form, zum Beispiel über verschlüsselte Messenger-Dienste wie Signal.