Deine Spende für die Menschen im Iran
Damit Menschenrechte nicht im Dunkeln verschwinden und Gerechtigkeit siegt.

Völkermord, Kriegsverbrechen, Folter – manche Verbrechen sind so schwerwiegend, dass die Weltgemeinschaft gefordert ist, Straflosigkeit zu verhindern. Für Überlebende schwerer Menschenrechtsverletzungen, insbesondere in Kriegen wie in der Ukraine oder in Syrien, ist es im Inland oft unmöglich, auf juristischem Weg Gerechtigkeit zu erlangen. Die Folge: Die Verantwortlichen bleiben straffrei. Das Weltrechtsprinzip soll sicherstellen, dass schwere Menschenrechtsverletzungen auch im Ausland verfolgt werden können. Im folgenden Text erfährst du, wie das Weltrechtsprinzip bestehende rechtliche Lücken schließen kann und warum auch Österreich einen Beitrag zur Stärkung der internationalen Strafverfolgung leisten muss.
Das Weltrechtsprinzip sieht die Zuständigkeit eines Staates beziehungsweise eines nationalen Gerichts für die strafrechtliche Verfolgung von schwerwiegenden internationalen Verbrechen vor, obwohl die Taten nicht auf eigenem Hoheitsgebiet und nicht durch oder gegen eine*n Staatsbürger*in des Landes begangen wurden. Dazu zählen Verbrechen wie Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Folter.
Die grundlegende Idee ist, dass diese Straftaten so schwerwiegend sind, dass universelle Werte verletzt und daher die Welt als Gemeinschaft betroffen ist. Das Weltrechtsprinzip ermöglicht nationalen Gerichten in Drittstaaten Völkerstraftaten juristisch aufzuarbeiten und Täter*innen zur Rechenschaft zu ziehen. Es zielt auch darauf ab, dass mutmaßliche Täter*innen dieser schweren Verbrechen dadurch nicht mehr so leicht Unterschlupf im Ausland finden, sondern überall auf der Welt belangt werden können.
Das Weltrechtsprinzip wird auch Prinzip der universellen Jurisdiktion genannt.
Die stützt sich auf internationale Gerichtshöfe wie den internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag und auf sogenannte ad-hoc Gerichtshöfe, also temporäre Gerichtshöfe. Letztere werden mit dem Ziel eingerichtet, bestimmte schwere Verbrechen, meist Völkerrechtsverbrechen, zu verfolgen und rechtlich aufzuarbeiten. Die internationale Gemeinschaft hat etwa Ad-hoc-Strafgerichtshöfe eingerichtet, um die Verbrechen im ehemaligen Jugoslawien, in Ruanda und in Sierra Leone zu behandeln.
Trotzdem ist es in vielen Fällen heute immer noch nicht möglich, Personen, die schwerster internationaler Verbrechen beschuldigt werden, der Justiz zu übergeben. Aufgrund beschränkter Ressourcen kann nur eine geringe Anzahl von Fällen verhandelt werden. Außerdem bestehen territoriale und politische Einschränkungen. So darf der internationale Strafgerichtshof beispielsweise nicht tätig werden, wenn das Land, in dem Völkerrechtsverbrechen begangen werden oder aus dem die Täter*innen stammen, kein Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofes ist. Das ist zum Beispiel bei den USA der Fall aber auch bei China, Indien, Russland und Israel – diese Staaten erkennen den IStGH nicht an. Auch wenn 124 Länder sich zum römischen Statut bekennen, der die Grundlage des IStGH bildet, fehlen somit mächtige Länder, die auch in aktuellen Konflikten eine wichtige Rolle spielen. Aus diesem Grund wird die internationale Strafverfolgung durch den IStGH immer wieder als zahnlos kritisiert.
Nationale Gerichte und Tribunale können im Zuge der Umsetzung des Weltrechtsprinzips diese bestehenden Lücken schließen. Das ist aufgrund der Schwere der begangenen Verbrechen von besonderer Bedeutung, denn Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit betreffen nicht nur Individuen und einzelne Länder, sondern die internationale Gemeinschaft und rechtfertigen deshalb besondere Maßnahmen. Je mehr Staaten das Weltrechtsprinzip aktiv anwenden, desto eher können bestehende Lücken der internationalen Strafgerichtsbarkeit geschlossen werden. Auch wenn die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt und bei Verurteilungen vorgesehene Haftstrafen mitunter nicht vollstreckt werden können, darf die Signalwirkung und die internationale Ächtung, die mit einer Verurteilung einhergeht, nicht unterschätzt werden.
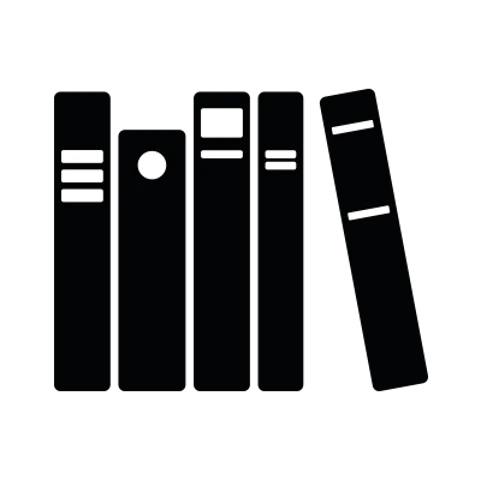
Internationale Strafverfolgung
Internationale Strafverfolgung
Strafverfolgung bezeichnet den Prozess, bei dem staatliche Behörden, insbesondere die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft, Straftaten untersuchen, Beweise sammeln und strafrechtliche Maßnahmen gegen Verdächtige einleiten. Ziel ist es, Straftäter*innen zur Verantwortung zu ziehen und die Rechtsordnung zu wahren. Die Strafverfolgung umfasst alle Schritte von der Ermittlung über die Anklageerhebung bis hin zur gerichtlichen Verhandlung und Verurteilung. Das Internationale Strafrecht wird bei besonders schweren Menschenrechtsverletzungen angewandt, wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Kriegsverbrechen. Bei der Strafverfolgung von Verbrechen gegen das internationale Strafrecht schließt dieser Prozess nicht nur die Durchführung eigener Ermittlungen, sondern auch die Unterstützung von Ermittlungen anderer Staaten und die Mitarbeit in internationalen Ermittlungsgruppen ein.
Internationale Strafverfolgung erfordert einen langen Atem und eine konsequente Umsetzung. Es ist daher entscheidend, dass die internationale Gemeinschaft – und damit jeder einzelne Staat im Rahmen der eigenen Möglichkeiten – Verantwortung übernimmt, damit die Überlebenden schwerster Verbrechen Gerechtigkeit erlangen.
Shoura Zehetner-Hashemi, Geschäftsführerin Amnesty International Österreich

Durch das Weltrechtsprinzip konnten in der Vergangenheit beispielsweise Kriegsverbrecher aus Ruanda in Deutschland und Nazi-Verbrecher in Israel verurteilt werden.
In jüngster Vergangenheit erregten Prozesse gegen (mutmaßliche) syrische Kriegsverbrecher in Deutschland viel Aufsehen: 2022 wurde der ehemalige syrische Offizier Anwar R. zu lebenslanger Haft wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt – es war das weltweit erste Verfahren zu staatlicher Folter in Syrien. Anwar R. war Teil des Geheimdiensts des Assad-Regimes und setzte sich nach Deutschland ab. Hier wurde er schuldig gesprochen, als Mittäter für 27 Morde, Folter, gefährliche Körperverletzung und sexualisierte Gewalt mitverantwortlich zu sein.
Auch beim Fall Alaa M. geht es um Vorwürfe unbeschreiblicher Grausamkeit gegen Gegner*innen des Assad-Regimes: Der in Deutschland lebende ehemalige Arzt soll in einem syrischen Militärkrankenhaus und einem Militärgefängnis Menschen gefoltert und misshandelt haben. Vor einem Gericht in Frankfurt begann 2022 auch gegen ihn der Prozess wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Für Überlebende von Menschenrechtsverletzungen ist das Weltrechtsprinzip häufig die einzige Chance auf Gerechtigkeit – so auch im Fall der Verbrechen des Assad-Regimes in Syrien: Das Land selbst ist kein Mitglied des Internationales Strafgerichthofs (IStGH) und Ermittlungen durch den Internationalen Strafgerichtshof werden auch durch Länder wie China und Russland blockiert. Die Verfahren in Deutschland sind daher besonders wichtig, um Straflosigkeit zu verhindern.
In Österreich ist das Weltrechtsprinzip als Grundlage für die Strafverfolgung von internationalen Verbrechen, die in anderen Staaten begangen wurden, bereits im § 64 des Strafgesetzbuches rechtlich verankert. Es wird jedoch häufig nicht angewendet, da keine ausreichende Verbindung zu österreichischen Interessen festgestellt wird und es auch an den notwendigen Ressourcen mangelt, internationale Verbrechen in Österreich zu verfolgen.
Blickt man auf die europäische Union, bietet sich ein differenziertes Bild: Grundsätzlich sehen die Rechtsordnungen der einzelnen Mitgliedstaaten der europäischen Union auch eine Form der universellen oder extraterritorialen Gerichtsbarkeit vor, um ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Zu den Mitgliedstaaten, die das Weltrechtsprinzip für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord ins nationale Recht übernommen haben, zählen neben Österreich auch Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Schweden.
Neben der Definition der Straftaten ist die Verabschiedung von Gesetzen, die die Ausübung der universellen oder extraterritorialen Gerichtsbarkeit unterstützen, ein Schlüsselelement für die erfolgreiche Verfolgung der wichtigsten internationalen Verbrechen. In den meisten Mitgliedstaaten bestehen jedoch wie in Österreich Hindernisse, da die Anwendung des Weltrechtsprinzips von bestimmten Bedingungen abhängig ist.
Österreich knüpft bei der Anwendung des Weltrechtsprinzips wie viele andere europäische Länder an die Anwesenheit beziehungsweise den Wohnsitz eines*einer Verdächtigen im Hoheitsgebiet an (von dieser Einschränkung ausgenommen: sexuelle und geschlechtsspezifische Straftaten). Auch die Gesetzgebung anderer europäischer Länder, beispielsweise Belgien, Kroatien und Niederlande, erfordert einerseits eine Vorabgenehmigung des Justizministeriums, der oder eines*r anderen Beamt*in. Andererseits darf nicht bereits ein Verfahren vor dem IStGH oder vor einem anderen zuständigen internationalen oder nationalen Gericht laufen, um ein Verfahren unter Anwendung des Weltrechtsprinzips einleiten zu können.
In zwölf EU-Mitgliedstaaten (Bulgarien, Zypern, Tschechien, Estland, Finnland, Deutschland, Ungarn, Lettland, Polen, Slowenien, Slowakei und Schweden) erfordert die Durchführung eines Verfahrens nach dem Weltrechtsprinzip keine spezifischen Kriterien. In der Praxis leiten auch diese Staaten jedoch nur dann ein Verfahren ein, wenn sich der*die Verdächtige in ihrem Hoheitsgebiet aufhält.
Im Jahr 2023 wurden in mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union Verfahren aufgrund des Weltrechtsprinzips durchgeführt. Die Anzahl der Verfahren hat sich in den letzten Jahren leicht erhöht. Dieser Trend wird wahrscheinlich aufgrund der Gräueltaten im Krieg gegen die Ukraine anhalten.
Fazit: Obwohl das Weltrechtsprinzip in den meisten EU-Mitgliedstaaten rechtlich verankert ist, beschränken sich nahezu alle auf dieser Grundlage durchgeführten Gerichtsverfahren auf einige wenige Mitgliedstaaten. So ergingen in Spanien von 2009 bis 2017 28 erstinstanzliche Urteile unter der Anwendung des Weltrechtsprinzips, seit 2018 jedoch kein einziges. Mittlerweile finden das Weltrechtsprinzip in zwei Ländern am häufigsten Anwendung: Deutschland (30 erstinstanzliche Urteile von 2014 bis 2024) und Frankreich (15 erstinstanzliche Urteile von 2014 bis 2024). Abgesehen von einigen wenigen Fällen, finden Gerichtsverfahren aufgrund des Weltrechtsprinzips nahezu ausschließlich in Europa statt.

Der syrische Menschenrechtsanwalt Anwar Al-Bunni widmet sich seit den 80er Jahren der Verteidigung politischer Gefangener. Im Jahr 2014 flüchtete er nach Deutschland.
In Berlin gründete er das Syrische Zentrum für juristische Studien und Forschung und kämpft für Gerechtigkeit für die Opfer hochrangiger syrischer Regime-Anhänger*innen, etwa indem er Zeug*innen an das Gericht vermittelt und Klagen vorbereitet.
Das Weltrechtsprinzip ist wichtig, weil es sicherstellt, dass schwerwiegende Verbrechen wie Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit weltweit verfolgt werden können, unabhängig davon, wo sie begangen wurden. Es trägt zur globalen Gerechtigkeit bei solchen Verbrechen bei und sorgt dafür, bestehende Lücken der internationalen Strafgerichtsbarkeit zu schließen.
Aimée Stuflesser, Juristin bei Amnesty International Österreich
Österreich hat eine Verantwortung, sich aktiv an der Aufarbeitung und Verfolgung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu beteiligen. Daher fordern wir: