Deine Spende für die Menschen im Iran
Damit Menschenrechte nicht im Dunkeln verschwinden und Gerechtigkeit siegt.
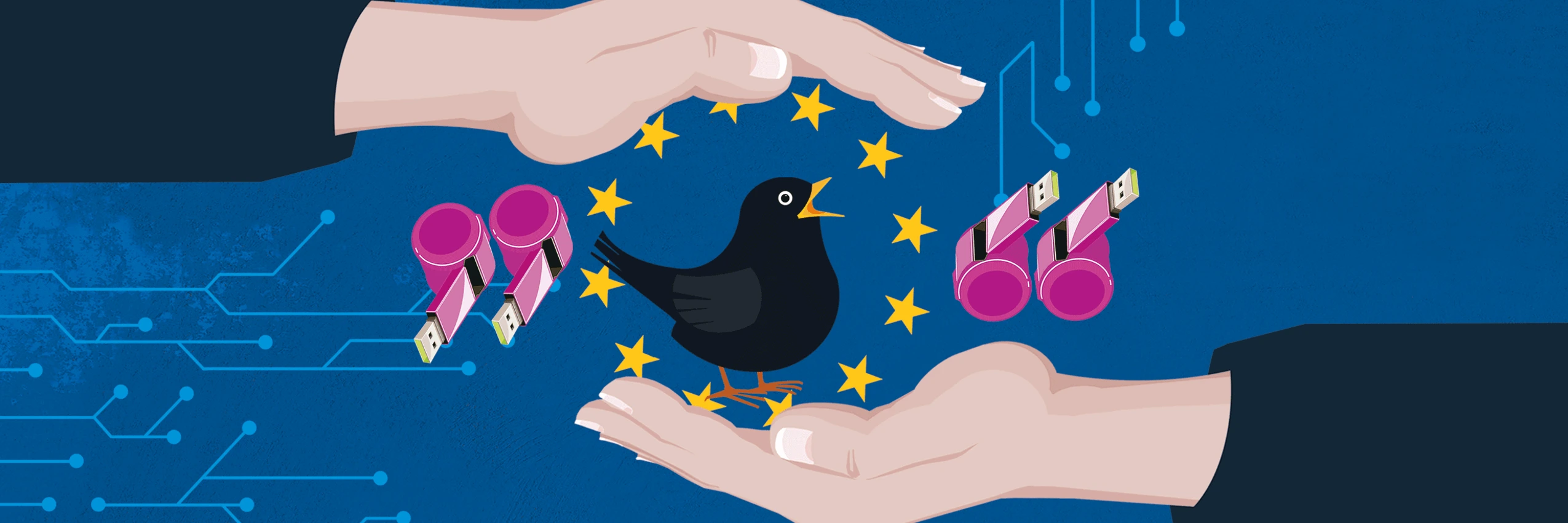
Der von der österreichischen Regierung vorgeschlagene Gesetzesentwurf zur Umsetzung der EU-Whistleblower*innen-Richtlinie ist unzureichend, um einen umfassenden Schutz für Hinweisgeber*innen zu gewährleisten, so Amnesty International heute in einem Statement zum Abschluss der Begutachtungsphase.
Einige Forderungen von Amnesty International sind bereits in der EU-Richtlinie als Mindeststandards vorgegeben: So die Wahrung der Vertraulichkeit und Anonymität von Hinweisgeber*innen und die Möglichkeit, sich auch an externe Meldestellen zu wenden. Auch wenn der Entwurf diese Mindeststandards erfüllt, weist er große Lücken im Schutz von Hinweisgeber*innen auf.
„Korruption ist ein massives Problem in Österreich. Whistleblower*innen leisten einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung von Korruption und zeigen immer wieder großen Mut, Straftaten aufzudecken. Dafür sollten sie nicht bestraft, sondern bestärkt und geschützt werden“, so Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich.
Dass Menschenrechtsverletzungen oder Korruption in Österreich in Zukunft effektiv aufgedeckt werden, liegt im Interesse aller Menschen in Österreich. Wenn auch unserer Politik etwas daran liegt, müssen sie den Entwurf nochmal gründlich überarbeiten!
Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich.
Am 3. Juni stellte Arbeitsminister Martin Kocher den österreichischen Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Whistleblower*innen-Richtlinie vor. Der Gesetzesentwurf kam über fünf Monate nach Ende der von der EU-Kommission vorgegebenen Frist zur Umsetzung der EU-Whistleblower*innen-Richtlinie (17. Dezember 2021) und einem eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren seitens der EU.
Die EU-Whistleblower*innen-Richtlinie besagt, dass Personen Missstände und Gesetzesverstöße innerhalb des Unternehmens oder der öffentlichen Institution, zu dem/der sie in einer beruflichen Verbindung stehen, melden können, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen.
Whistleblowing, also das Melden von Fehlverhalten, ist Teil des Rechts auf freie Meinungsäußerung und damit durch Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt. Es ist oftmals die einzige Möglichkeit, Menschenrechtsverletzungen ans Licht zu bringen, die der Öffentlichkeit sonst verborgen bleiben würden.
Erst kürzlich hat ein österreichischer Whistleblower, Gökhan S., eine Sicherheitslücke auf österreich-testet.at aufgedeckt. Über diese Lücke war es möglich, persönliche Daten von potenziell hunderttausenden Personen in Österreich aus dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) abzurufen, was eine massive Verletzung ihres Rechts auf Privatsphäre darstellen würde. Nach seinen Enthüllungen wurde Gökhan S. von seinem Arbeitgeber entlassen.
In vielen Fällen werden jedoch nicht diejenigen verfolgt, die Menschenrechte verletzt haben, sondern jene, die diese menschenrechtswidrigen Handlungen enthüllten. Dies macht den Schutz von Whistleblower*innen für die Wahrung der Menschenrechte umso wichtiger.