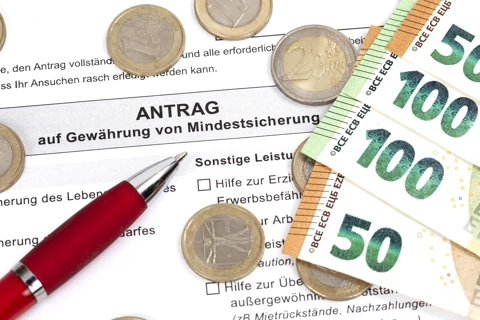Chinas Justiz als Waffe gegen Verteidiger*innen von Menschenrechten
1. Oktober 2025Menschenrechtsverteidiger*innen sollen in China zum Schweigen gebracht werden. Das deckt ein neuer Amnesty-Bericht auf. Chinesische Gerichte formulieren systematisch vage Gesetze über die nationale Sicherheit und öffentliche Ordnung, um den Behörden in Peking bei der Unterdrückung der Grundfreiheiten zu helfen.
Der am chinesischen Nationalfeiertag veröffentlichte Bericht mit dem Titel How could this verdict be „legal“? wertet mehr als 100 offizielle Gerichtsdokumente aus, die in 68 Verfahren gegen insgesamt 64 Menschenrechtsverteidiger*innen zwischen 2014 und 2024 entstanden sind. Er beschreibt, wie chinesische Gerichte friedliche Aktivist*innen, Journalist*innen, Anwält*innen, aber auch nicht politisch engagierte Bürger*innen pauschal verurteilen, oft auf der Grundlage von Äußerungen, Verbindungen zu anderen Personen oder internationalen Kontakten.
Die chinesische Führung spricht gerne über internationale Zusammenarbeit und ihren Einsatz für die Rechtsstaatlichkeit. Doch in Wirklichkeit steckt hinter dieser Maske ein System, in dem chinesische Gerichte sich in Unterdrückung statt in Gerechtigkeit üben, wenn politisch brisante Fälle verhandelt werden.
Sarah Brooks, für China zuständige Direktorin bei Amnesty International
Menschenrechtler*innen in China werden als Staatsfeinde behandelt, weil sie ihre Meinung geäußert, sich friedlich organisiert oder mit der Außenwelt Kontakt aufgenommen haben. Ihre Tapferkeit wird mit Gefängnis, Folter und Scheinprozessen bestraft.
In mehr als 90% der von Amnesty International untersuchten Fälle stützten sich die Gerichte auf Bestimmungen über die nationale Sicherheit oder öffentliche Ordnung, die vage Definitionen enthalten, übermäßig weit gefasst sind und internationalen Standards zuwiderlaufen. Am häufigsten wurden Vorwürfe erhoben wie „Untergrabung der Staatsgewalt“, „Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt“ und „Provokation von Streit und Sabotage der gesellschaftlichen Ordnung“, was die Behörden in die Lage versetzte, friedliche Äußerungen und Vereinigungen zu kriminalisieren.
Häufig zogen die Gerichte Online-Inhalte wie Blogbeiträge, Kommentare in den Sozialen Medien oder das Teilen von Menschenrechtsartikeln als Beweis für „Untergrabung der Staatsgewalt“ heran.
Internationale Aktivitäten wurden routinemäßig als kriminelle Aktivitäten gebrandmarkt. So wurden beispielsweise Interviews mit ausländischen Medien, die Veröffentlichung von Artikeln auf ausländischen Websites oder die Teilnahme an Schulungen von NGOs im Ausland als Beweise für eine „geheime Absprache mit ausländischen Kräften“ angeführt.
Gleichzeitig wurden die Verfahrensrechte der Betroffenen durchweg verletzt: Angeklagte hatten keinen Zugang zu Rechtsbeiständen ihrer Wahl, mussten lange Zeit in Untersuchungshaft verbringen oder wurden unter „Überwachung an einem dafür vorgesehenen Ort“ gestellt – eine Praxis, die dem Verschwindenlassen gleichkommt und in manchen Fällen als Folter und andere Misshandlung eingestuft werden kann. In 67 von 68 geprüften Fällen, in denen Urteile ergangen sind, wurden die Angeklagten schuldig gesprochen. Bis auf drei Personen wurden alle zu Gefängnisstrafen zwischen 18 Monaten und 19 Jahren verurteilt.
Grundfreiheiten werden kriminalisiert
Amnesty stellte fest, dass die chinesischen Gerichte Kritik an der Regierung systematisch mit einer Bedrohung der nationalen Sicherheit gleichsetzten. In einem Fall wurde ein Menschenrechtsanwalt wegen „Untergrabung der Staatsgewalt“ verurteilt, nachdem er Personen in politisch sensiblen Fällen vertreten und die Familien von Inhaftierten unterstützt hatte.
Ein weiteres Beispiel ist der mittlerweile verstorbene Nobelpreisträger Liu Xiaobo, der zu elf Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er die Charta 08 mitverfasst hatte, ein politisches Manifest, das politische Reformen einforderte. Auch Frauen, die sich für die Menschenrechte einsetzen, werden ins Visier genommen. Eine Aktivistin wurde wegen “Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt“ schuldig gesprochen, weil sie Artikel über Frauen- und Landrechte verfasst hatte.
Die Behörden können jedes Verhalten oder jede Handlung als kriminell einstufen.
Chinesische Menschenrechtsanwältin, mit der Amnesty für den Bericht gesprochen hat
Amnesty dokumentierte zudem die strafrechtliche Verfolgung von Arbeitsrechtsaktivist*innen, weil sie Arbeitnehmer*innen bei Tarifverhandlungen unterstützt hatten und von Petitionssteller*innen, die ihre Anliegen bei höheren Behörden vorgebracht hatten. Friedliche Versammlungen wurden routinemäßig unter dem Deckmantel der „Störung der sozialen Ordnung“ verfolgt.
Internationale Aktivitäten - ein Verbrechen?
In mehr als der Hälfte der geprüften Fälle setzten die Gerichte internationale Aktivitäten mit Kriminalität gleich. Die Angeklagten wurden der „geheimen Absprache“ beschuldigt, weil sie bescheidene Finanzmittel von NGOs erhalten, mit ausländischen Journalist*innen gesprochen oder auch nur Server im Ausland gemietet hatten.
In einem Fall argumentierten die Behörden, dass die Veröffentlichung von Artikeln auf einer gesperrten ausländischen Website eine Störung der öffentlichen Ordnung in China darstellte, obwohl die gesamte Website in China aufgrund der Zensur gar nicht zugänglich war. In einem anderen Fall wurde der Besitz von öffentlich zugänglichen politischen Dokumenten als „illegale Weitergabe von Staatsgeheimnissen an das Ausland“ angesehen.
„Indem die chinesische Regierung fast jede Form von Kontakt mit der internationalen Gemeinschaft unter Strafe stellt, versucht sie, Menschenrechtler*innen in China von der Außenwelt abzuschneiden. Hier geht es nicht um die nationale Sicherheit, sondern um reine politische Kontrolle“, sagte Sarah Brooks.
Die Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger*innen in China bewirkt außerdem, dass nicht nur die direkt Betroffenen eingeschüchtert werden. Indem die Behörden friedlichen Aktivismus mit einer Bedrohung der nationalen Sicherheit gleichsetzen, zielen sie darauf ab, überall in der Gesellschaft kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen.
Sarah Brooks, für China zuständige Direktorin bei Amnesty International
Systematische Verweigerung von fairen Verfahren
In allen geprüften Fällen stellte Amnesty International Verstöße gegen die Verfahrensrechte fest. Alle 64 Angeklagten wurden willkürlich in Gewahrsam gehalten. Viele befanden sich monatelang ohne Kontakt zur Außenwelt in Haft, und mindestens 15 wurden unter dem System der „Überwachung an einem dafür vorgesehenen Ort“ festgehalten.
In elf Fällen, in denen Rechtsbeistände Foltervorwürfe erhoben, wiesen die Gerichte diese ohne Untersuchung zurück und legten die Beweislast häufig den Angeklagten auf.
Unter dem Vorwand von „Staatsgeheimnissen“ wurden Familien, Medien und Diplomat*innen routinemäßig von den Gerichtsverhandlungen ausgeschlossen, selbst wenn die Anklagen nichts mit Geheimsachen zu tun hatten. In einigen dieser Fälle behaupteten die Gerichte gar, dass die Verfahren in Wirklichkeit offen zugänglich gewesen seien.
In 67 von 68 Fällen verhängten die Gerichte Freiheitsstrafen. Oftmals wurde als zusätzliche Strafe ein „Entzug der politischen Rechte“ verfügt, sodass die Betroffenen auch nach ihrer Freilassung nicht mehr die Möglichkeit hatten, ihre Meinung zu äußern, Publikationen zu veröffentlichen oder sich organisierten Bewegungen anzuschließen.
Niemand ist sicher
Wir fordern die chinesische Regierung erneut auf, die vagen und übermäßig weit gefassten Bestimmungen des Strafgesetzes – wie „Untergrabung der Staatsgewalt“ und „Provokation von Streit“ – sowie das Gesetz über die Nationale Sicherheit von 2015 aufzuheben oder grundlegend zu überarbeiten.
Zudem verlange wir die Abschaffung der „Überwachung an einem dafür vorgesehenen Ort“ und aller Formen der Haft ohne Kontakt zur Außenwelt, und appellieren an die Behörden, das Recht der Angeklagten auf ein faires Gerichtsverfahren zu gewährleisten. Hierzu zählen der Zugang zu Rechtsbeiständen ihrer Wahl und der Ausschluss von Beweisen, die mittels Folter erlangt wurden.
„Die chinesische Regierung muss all jene umgehend und bedingungslos freilassen, die lediglich aufgrund der friedlichen Wahrnehmung ihrer Rechte auf Meinungs-, Vereinigungs- oder Versammlungsfreiheit inhaftiert sind“, so Sarah Brooks.
Wenn Rechtsbeistände inhaftiert werden, weil sie ihre Mandant*innen verteidigt haben, wenn Petitionssteller*innen bestraft werden, weil sie sich um Gerechtigkeit bemüht haben, und wenn Autor*innen für ihre Worte ins Gefängnis kommen, dann ist die Botschaft klar: Niemand ist sicher. Trotz alledem bleiben chinesische Menschenrechtsverteidiger*innen standhaft – und die Welt muss ihnen zur Seite stehen.
Sarah Brooks, für China zuständige Direktorin bei Amnesty International
Hintergrund
Der Amnesty-Bericht basiert auf der Auswertung von 102 offiziellen Anklagen und den Urteilen in 68 Verfahren gegen insgesamt 64 Menschenrechtsverteidiger*innen zwischen 2014 und 2024, auf die UN-Menschenrechtsmechanismen aufmerksam machten.