Deine Spende für die Menschen im Iran
Damit Menschenrechte nicht im Dunkeln verschwinden und Gerechtigkeit siegt.
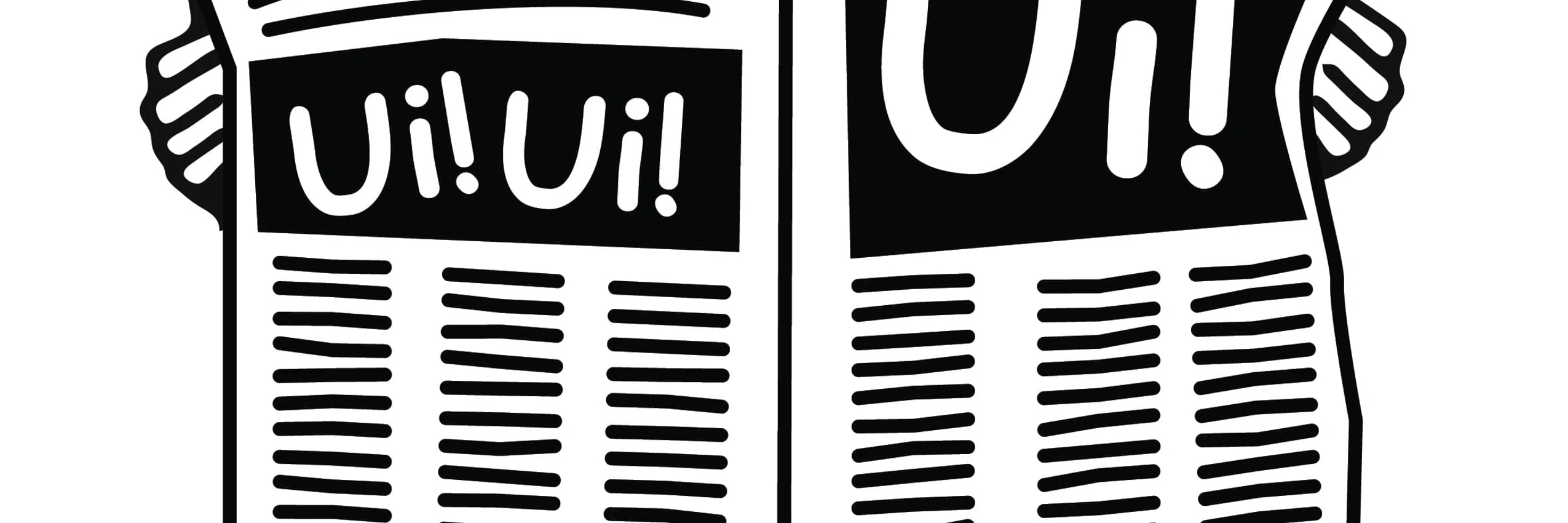
Medien gelten als vierte Gewalt in der Demokratie. Doch das Vertrauen in journalistische Inhalte sinkt. Ein Institut in Bonn und eine Redaktion in Wien zeigen Wege aus der Nachrichtenmüdigkeit.
Vertrauen Sie noch den Medien? Mehr als ein Drittel der Österreicher*innen meidet Nachrichten „oft“ oder „manchmal“, wie eine Umfrage von Reuters im vergangenen Jahr ergab. Demnach sank auch das Vertrauen in Nachrichten das zweite Jahr in Folge. Nicht einmal die Hälfte der Befragten hält Nachrichtenmedien grundsätzlich für vertrauenswürdig.
Kein besonders positiver Einstieg in einen konstruktiven Beitrag. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Vielmehr stellt sich die Frage: Was tun gegen das schwindende Vertrauen und die Verdrossenheit gegenüber den Medien?
Antworten auf diese Fragen könnte der konstruktive Journalismus liefern, der einen ausgewogeneren und lösungsorientierteren Ansatz in der Berichterstattung anstrebt. Im Gegensatz zu herkömmlichem Journalismus, der sich stark mit negativen Ereignissen und deren Folgen befasst, versucht der konstruktive Journalismus, neben den Herausforderungen auch mögliche Lösungen aufzuzeigen. Auf diese Weise will er das Publikum befähigen, ein Bewusstsein für die eigene Handlungsfähigkeit zu entwickeln.
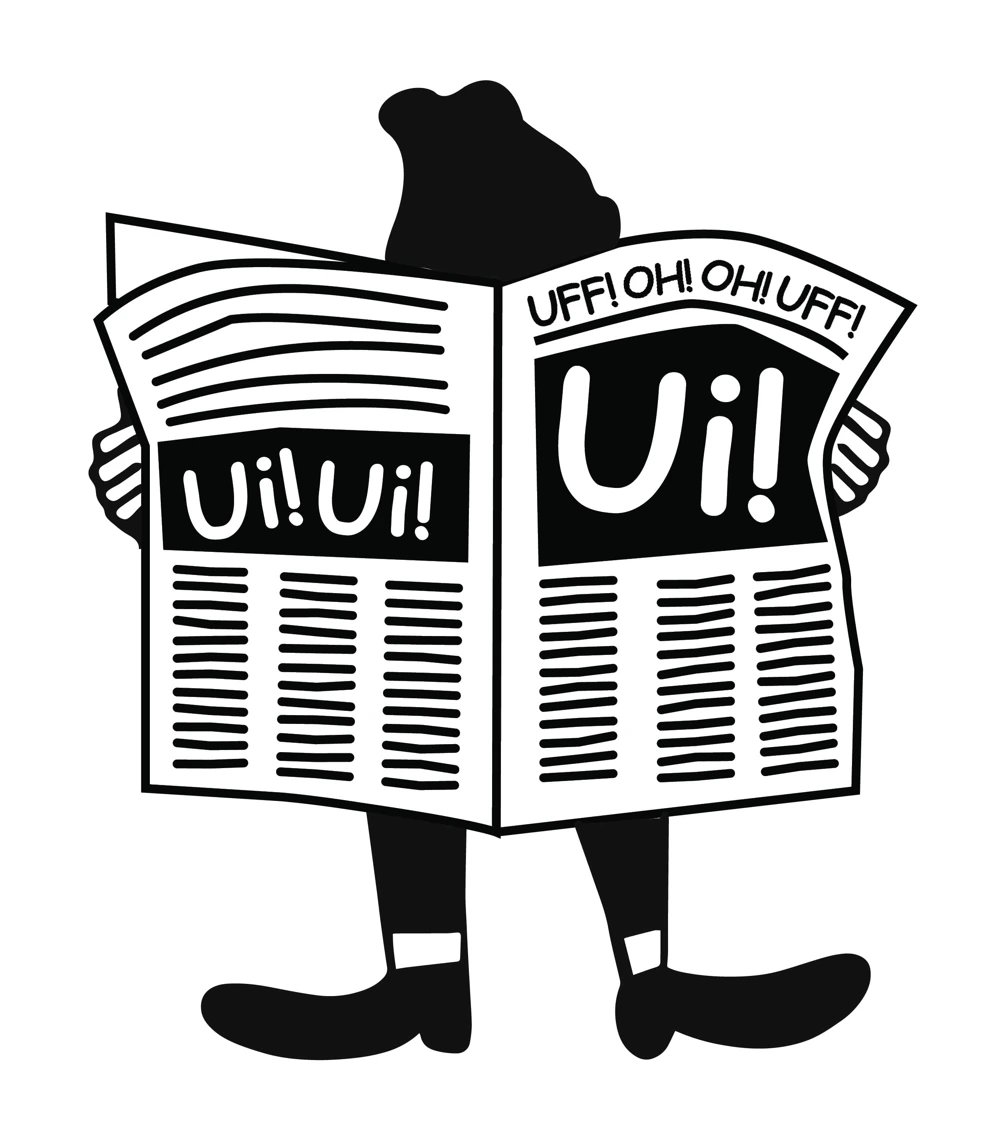
Immer mehr Menschen neigen dazu, schlechte Nachrichten zu meiden, weil sie das Gefühl haben, sie können ohnehin nichts gegen die Probleme in der Welt unternehmen.
Ellen Heinrichs, Gründerin des Bonner Instituts für konstruktiven Journalismus
Dies führe zu einem Gefühl der Machtlosigkeit und oft zu dem Entschluss, überhaupt keine Nachrichten mehr zu konsumieren.
Das Bonner Institut versucht, dieser Entwicklung mit Forschung und Fortbildungen zu konstruktivem Journalismus entgegenzuwirken. Dabei steht ein besonders kritischer Blick auf die dargestellten Lösungsansätze im Mittelpunkt:
„Konstruktiver Journalismus ist aus meiner Sicht besonders objektiver Journalismus, weil er das ganze Bild in den Blick nimmt und sich nicht nur einseitig auf alles fokussiert, was schlecht läuft“, sagt Heinrichs.
Dass die Arbeit des Bonner Instituts auf dem richtigen Weg ist, zeigen Studien zur Wirksamkeit: Konstruktiver Journalismus kann sich positiv auf das Gemeinschaftsgefühl auswirken sowie die Bereitschaft erhöhen, gemeinsame Interessen zu verfolgen, und stärkt positive Emotionen wie Widerstandsfähigkeit.
Damit der Blick über den Tellerrand gelingt, müssen vor allem Journalist*innen ihre eigene Arbeitsweise und die der Redaktion reflektieren und erweitern, so Heinrichs. Fragen wie „Gibt es vielleicht Perspektiven, die in der Berichterstattung bislang zu kurz gekommen sind?“ können dabei helfen, Vielfalt in redaktionelle Inhalte zu bringen und diese schlussendlich für mehr Menschen relevant zu machen.
Dieser lösungsorientierte Journalismus benötigt für Heinrichs kein zusätzliches Label: „Das ist für mich einfach faktengesicherter Journalismus, der hilfreich für die Gesellschaft und auch Medienmachende ist, weil er von ihrem Publikum als relevant erlebt wird. Wenn wir Journalismus nicht als relevant erleben, konsumieren wir ihn nicht.“
Ohne Label, aber mit dem Gespür für einen journalistischen Ansatz, der am österreichischen Medienmarkt fehlt, startete im vergangenen Jahr „Tag eins“, das „Magazin für Veränderung“. Das Online-Format möchte Leser*innen mit konstruktiven Geschichten und lösungsorientierten Inhalten aus der Katastrophenstarre holen.
„Unser Ausgangspunkt war die Frage: Wie kann ich mich informieren, ohne von der Weltlage völlig überfordert und dadurch handlungsunfähig zu werden?“, erzählt Anna Mayrhauser, Chefredakteurin von Tag eins.
Die „Tag eins“ Redaktion orientiert sich bei ihrer Berichterstattung an klaren Kriterien, um nicht Gefahr zu laufen, Themen schlicht „abzufeiern“ und damit in die PR-Falle zu tappen – etwas, das dem konstruktiven Journalismus häufig vorgeworfen wird.
Natürlich soll man auch über Organisationen oder Einzelpersonen berichten, die etwas bewegen. Trotzdem muss man immer eine kritische journalistische Distanz wahren.
Anna Mayrhauser, Chefredakteurin von Tag eins
Ein Jahr nach der Gründung kämpft Tag eins um die Finanzierung ihres konstruktiven Formats. „Wir haben gesehen, dass es in der Aufmerksamkeitsökonomie des Internets schwieriger ist, mit konstruktivem, lösungsorientiertem Journalismus durchzukommen als mit Clickbaits. Das gehört halt leider auch dazu“, beklagt Mayrhauser.
Trotz der Schwierigkeiten ist sie überzeugt, dass es Menschen gibt, die sich nach Entschleunigung sehnen und eine Pause von der Nachrichtenflut brauchen: „Ich glaube, dass konstruktiver Journalismus dazu beitragen kann, dieser Überforderung entgegenzuwirken.“
Seit Kurzem produziert die Reaktion auch den konstruktiven Newsletter „Na gut“ der Wiener Zeitung. Künftig will sich das Magazin mit Beiträgen aus der Kernredaktion und einem halbjährlichen Schwerpunkt auf ausgewählte Themen konzentrieren.
Neben mehr Geld, sind auch die Ausbildungssituation und die personelle Besetzung der Redaktionen ein Punkt, der es schwierig macht, perspektivischen Journalismus und die Arbeit von Formaten wie Tag eins zu betreiben, schildert Mayrhauser.
Es sei sehr hart, Journalist*in zu werden, besonders wenn Menschen aus finanziell benachteiligten Verhältnissen kommen oder Migrationshintergrund haben. Das führe dazu, dass österreichische Redaktionen alle sehr homogen sind und die Menschen meist akademische Lebensläufe mitbringen. Hinzu kommen unbezahlte Praktika und oft jahrelange freie Arbeitsverhältnisse.
Die Studie „Diversität und Journalismus“ aus dem Jahr 2021 unterstreicht diese Hürden: Nur sechs Prozent der österreichischen Journalist*innen hatten laut der Ergebnisse einen nicht-deutschsprachigen Migrationshintergrund. Grund dafür sind nach wie vor hohe Zugangsbarrieren und mangelnde Repräsentation, wodurch sich Menschen mit Migrationshintergrund von klassischen Medien selten angesprochen fühlen.
Um konstruktiven, perspektivenreichen und lösungsorientierten Journalismus in die Breite der österreichischen Redaktionen zu bringen, braucht es Vielfalt bei den Menschen, die diesen machen, so Mayrhauser: „Wenn Journalist*innen unterschiedliche Hintergründe haben, dann ist es auch gut für den Journalismus. Nicht nur aus Repräsentations- oder Diversitätsgründen, sondern auch für die Inhalte, die entstehen.“
In Anbetracht der gegenwärtigen Herausforderungen für den Journalismus kann die Förderung von Perspektivenreichtum und Lösungsorientierung einen Beitrag dazu leisten, das Vertrauen zwischen Redaktionen und ihrem Publikum wiederherzustellen, betont Mayrhauser: „Natürlich brauchen wir trotzdem unterschiedliche Formen vom Journalismus, aber ich bin überzeugt, dass diese sich sehr gut ergänzen können.“
Konstruktiver Journalismus gilt demnach nicht lediglich als Ansatz, sondern als Aufforderung an alle, die journalistische Inhalte produzieren. In Zukunft wird es auch darum gehen, mehr Möglichkeiten der Teilhabe zu schaffen, sowohl innerhalb der Redaktionen als auch im Dialog mit dem Publikum.
Heinrichs ist davon überzeugt, dass das Gefühl, gesehen und gehört zu werden, eine wesentliche Voraussetzung für das Publikum ist, um das Vertrauen in die Medien zurückzugewinnen: „Es gibt nach wie vor eine Vielzahl von Menschen, die daran interessiert sind, erreichbar zu bleiben. Als Journalist*in ist es von essenzieller Bedeutung, zuzuhören und verstehen zu wollen, worum es den Menschen wirklich geht.“
Text: Julia Trampitsch

Informieren, inspirieren, mobilisieren: Das Amnesty Magazin versorgt dich mit Neuigkeiten über Menschen und ihre Rechte aus Österreich und der Welt.
Interviews, Aktionen und Geschichten, über Menschen, die uns bewegen – hol dir das kostenlose Probeabo und erhalte die nächsten zwei Ausgaben des Ammesty Magazins per Post zugestellt!